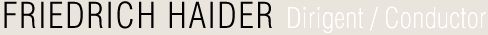„Ich bin gewissermaßen selbstverständlich…“
zur Musik Ermanno Wolf-Ferraris und seinem Intermezzo „Il segreto di Susanna“
Friedrich Haider (2005)
Veröffentlicht im Beiheft der Gesamteinspielung der Oper bei „Philartis Vienna“
Wie oft ist in der Musikgeschichte der Fall eingetreten, daß das Werk hoher Künstlerschaft den Geist zweier Nationen gleichzeitig geatmet hat? Wie oft hat ein Kulturkreis einen anderen derart durchdrungen, daß darin eine völlig neue Kunstsprache ihre Entstehung feiern konnte? An Frédéric Chopin, den „französischen Polen“, denkt man da vor allem. Daß es im ersten Drittel des 20.Jahrhunderts einen ebenso herausragenden Fall gegeben hat, ist – zumindest heute, zu Beginn des 21.Jahrhunderts – nahezu völlig in Vergessenheit geraten: Ermanno Wolf-Ferrari, Sohn eines deutschen Vaters und einer italienischen Mutter, aufgewachsen in Venedig und ausgebildet in München, hat mit seinem Werk eine faszinierende Verschmelzung romanischen und germanischen Geistes und Temperaments geschaffen.
Die Werke dieses Komponisten waren fast immer Wechselbädern des Erfolgs ausgesetzt. Das frühe Schaffen des 20, 25-jährigen geriet zwar in kürzester Zeit zu Weltruhm, führte aber bereits nach dem 1.Weltkrieg eine eher unstete Präsenz auf den Spielplänen; und in den letzten Jahrzehnten ist es, von einigen Ausnahmen abgesehen, völlig von der Bühne verschwunden. Aus zahllosen Beispielen der Vergangenheit weiß man freilich, daß solche Entwicklungen nur selten mit der „minderen Qualität“ des Geschaffenen zu tun haben (wie wäre sie überhaupt zu definieren?…), sondern daß es vielmehr Zeitgeist und dessen Auswirkung auf die Menschen ist, der bestimmte kulturelle Phänomene ins Rampenlicht stellt oder aber in den Hintergrund drängt.
Kunst kennt keinen Fortschritt
Schon zu seinen Lebzeiten meinte man, ihn in eine Art Anachronisten-Ecke stellen zu müssen. Man konnte oder wollte nicht verstehen, daß in einer Zeit, in der „Fortschritt“ vor allem durch das Vordringen zu Atonalität und formaler Auflösung definiert war, ein Deutsch-Italiener unbeirrt an der Tonalität festhielt, seinen „unerschöpflichen Goldoni“ zum „großen venezianischen Abgott“ erklärte, und ausgerechnet Lustspiel-Opern schrieb, deren künstlerische Physiognomie sich zumindest vordergründig so darstellte, als ob bestimmte Entwicklungen rund um ihn herum überhaupt nie stattgefunden hätten. Doch spricht nicht auch gerade das für einen ganz besonderen inneren Auftrag und hohe, eigenständige Künstlerschaft?! In Wahrheit kann es doch keine wirklich ernsthafte Frage sein, ob etwa Bartok „moderner“ als Debussy oder Richard Strauss „progressiver“ als sein Konkurrent Wolf-Ferrari gewesen sei. In der Kunst hat es den definierten „Fortschritt“ nie gegeben, auch wenn manche Theoretiker ihn immer wieder herbeikonstruieren wollten. Wie wenig das Moderne modern, und das Aktuelle auch wirklich aktuell ist, brachte einmal Alfred Polgar in einem Bonmot auf den Punkt: „Gestern noch eine Sache von übermorgen, heute schon eine von vorgestern. Wie die Zeit vergeht!“ Nichts ist daher verwegener, als formalästhetische Ansprüche zu stellen, in denen der vielleicht bedeutendste Faktor des Wesens „Kunstwerk“ ausgeklammert wird, nämlich seine neu geschaffene, dem Begrifflichen abgewandte Sprache, die sich wie ein Wunder vor den Menschen ausbreitet! Am Treffendsten hat Wolf-Ferrari es selbst ausgedrückt, wenn er auf eine Umfrage zur Gegenwart und Zukunft der Oper antwortete: „Man soll gute Opern schreiben. Das ist alles. W i e man das macht? Das kann ich nicht sagen; denn das „Wie“ ist jedes Mal die einzelne Oper selber, und bei jeder ist es immer wieder anders. Wenn man beim Begriff angelangt ist, hat man den Standpunkt der Kunst schon verlassen.“
Im Werk Ermanno Wolf-Ferraris offenbart sich eine vollkommen neue Welt. Eine Kunst-Welt, die uns, obwohl sie bestimmte Strömungen und Entwicklungen ihrer Zeit negiert, in ihrem erneuernden Umgang mit der Tradition und ihrer verwandelnden Wiederbelebung historischer Stilistiken als ganz und gar individuell begegnet. Ein eigener Tonfall nimmt hier Gestalt an, wie auch unverwechselbare Wolf-Ferrarische „Wendungen“ Einzug halten. In Zusammenhang mit seinem Werk das Wort reaktionär zu gebrauchen (was nicht selten geschehen ist) hieße, etwa auch die gesamte Malerei der Renaissance oder die Werke Johannes Brahms‘ als regressiv einzustufen.
Das Geheimnis der Schönheit ist zeitlos
Rührt sein lebenslanges Streben nach Harmonie, seine Verherrlichung der Schönheit, von dem frühen Kindeseindruck her, als sein Vater jene Kopien von Veronese, Tintoretto oder Bellini hergestellt hat, die heute in Münchens Schack-Galerie zu bewundern sind? Oder sucht und findet er in der überirdischen Kunst-Schönheit jene persönliche Befreiung, die ihm in der irdischen Welt stets versagt geblieben ist? In jedem Falle darf er als einer der letzten Komponisten (zumal des 20.Jahrhunderts) bezeichnet werden, der absolut und bedingungslos dem geheimnisvollen Phänomen „Schönheit“ huldigt. Schönheit, meinte Wolf-Ferrari, sei „nicht die Summe ihrer Elemente, sondern deren Beziehungen untereinander: unsagbar!“ und schrieb 1933 an den Komponisten Mark Lothar: „Wir Menschen der Schönheit sind die Wehrlosesten: noch wehrloser als die Menschen des Gedankens, die Philosophen, denn Gedanken sind an und für sich immer Kampfansage, immer geharnischt. Gedanken können ja nie etwas anderes sein, als Behauptungen gegen Behauptungen. Aber Schönheit ist bloß da, behauptet nichts, kämpft nicht, ist bloß da.“ Wollte der Komponist damit einer Schönheit frönen, die sich selbst genügen will? Gewiß nicht. Es ist eine mit durchgeistigtem Auge gesehene Schönheit, und sie ist „zeitlos“, wie Alexandra Carola Grisson in ihrer Biografie über den Komponisten schreibt, „erhaben (..) über jede Epoche und jeden Stil.“ Tatsächlich ist der Ausdruck „zeitlos“ das vielleicht Treffendste was über die Musik Wolf-Ferraris überhaupt gesagt werden kann. „Ich bin gewissermaßen selbstverständlich“ sagte er einmal, und meint damit auch, daß seinem Werk eine billig nach Außen gekehrte Sensation gänzlich fehle. Wolf-Ferraris Musik gehört der Ewigkeit. So etwas ist für Unkunst-Naturen, die das Stil-Etikett brauchen, natürlich immer ein Stein des Anstoßes.
Erstaunlich, wohin überall man ihn hat stecken wollen, diesen apollinischen Musikphilosophen, in dessen Werken sich die Spuren von Bach (er liebte seine unvergleichliche „Harmonie des Mathematischen mit dem Irrationalen“), der Mozartschen Metaphysik, der Volksstimme Haydns, der Sprache des Barbiere, des Don Pasquale, des spezifischen Falstaff-Parlandos, puccinesker oder straussischer „Wendungen“ manchmal fast gleichzeitig erfühlen lassen. Den Meisten fiel es daher am leichtesten, ihm ganz einfach das Prädikat „Eklektiker“ auszustellen. Tiefgründig auseinandergesetzt hat sich mit dieser künstlerischen Physiognomie bislang noch kaum jemand. „Nach Ihrer Einteilung würde ich zu den Epigonen zählen, nicht wahr?“ schrieb Wolf-Ferrari dem Kritiker Hans Tessmer 1927. „Ungefähr so wie ich ein Epigone meines Vaters bin, weil ich ihm (hoffentlich) irgendwie ähnlich bin. Wer weiß, wer dieses Wort geprägt hat, wie auch das andere: den Eklektiker. Will man vielleicht die völlige Vaterlosigkeit? Das versuchen ja die anderen, von denen Sie sprechen: die alles ab ovo anfangen: die Extremisten des Suchens.“
Obwohl die Wesenheit der Wolf-Ferrarischen Musik nicht wirklich in Worte zu fassen ist, lassen sich bestimmte Erscheinungsmerkmale doch sehr klar festmachen. Bedeutend ist zunächst einmal die absolute Konzentration des Materials, das Gedrungene des Gesagten. Wolf-Ferrari schreibt mit einer für das frühe 20.Jahrhundert außergewöhnlichen Ökonomie der Mittel und erreicht – mit großer Noblesse – dadurch auch eine Sublimierung der Gefühlsebene. Die reale menschliche Leidenschaft konnte er nie wirklich ernst nehmen. „Meine Werke sind Bändigung, nicht Ausleben“ meinte er, „deswegen passe ich schlecht zu unserer Zeit, die ich auch nicht recht verstehe.“ Ausnahmen wie etwa der an die Verismo-Strömung konzedierte „Schmuck der Madonna“ (Uraufführung: 1911) bezeichnete er daher als nicht wirklich zu seinem Ich gehörig. „Es ist sehr leicht, unverständlich zu schreiben! Sehr schwer hingegen: leicht zu schreiben ohne Dummheiten zu sagen! Den Jungen würde ich raten, so zu schreiben, wie man ein Telegramm nach Amerika aufsetzt: Kurz, weil die Worte teuer sind, und klar, weil man verstanden sein will!“ und „…wer nicht Freude an der Zeichnung hat, sondern bloß für Farbe schwärmt, hat nicht viel übrig für meine Musik.“ Das alles sind Worte, die punktgenau auf das filigrane Liniengeflecht und die Transparenz seines musikalischen Satzes verweisen. Auch die Harmonisierung eines melodischen Vorgangs ist in dieser Musik nicht einfach „Kolorierung“ sondern „wesentlicher Organismus, System“, wie die Opern-Instrumentationen immer den feinsten dramaturgischen Regungen folgen und eine klangliche Sinngebung des gesungenen Wortes finden. Nur der, der die Partituren Wagners und Strauss’ nicht detailgenau kennt, kann behaupten, Wolf-Ferrari habe im Verhältnis von Singstimme und Orchesterbehandlung keine neuen psychologischen Dimensionen erschlossen!
Wolf-Ferrari blieb Zeit seines Lebens ein grüblerischer Analytiker, beschäftigte sich eingehend mit Harmonielehren und Musikanalysen: jene von Halm, Thuille, Schönberg oder Riemann kannte er sehr genau. Was er dort suchte, war jedoch nie die Theorie selbst, sondern die höhere Dimension des musikalischen Instinkts, die Dimension des hörenden Menschen; und so hielt er Riemann für einen reinen Begriffsmenschen („Wenn die Musik so kompliziert wirken müsste, wie er sie erklärt, so wäre sie die grässlichste aller Künste anstatt die sinnlichste“) und zeigte sich zuguterletzt nur von den Ausführungen Ernst Kurths begeistert, jenem Musikwissenschafter, der sowohl mit seinen Studien zu Bach wie auch zur Tristan-Harmonik in Bereiche vorstieß, die einem Nur-Theoretiker wohl immer verschlossen bleiben. Wolf-Ferrari suchte ausschließlich das „Dahinter“ wenn er meinte, das eigentlich Wahre der Kunst stünde immer über den Kunstregeln. So erscheint auch die Dimension des Kontrapunkts, die in seinem Werk nicht vorherrscht aber doch eine deutliche Präsenz aufweist, nie als Selbstzweck sondern als Mitträger des poetischen Ausdrucks.
„Il segreto di Susanna“ und der neue musikalische Komödienton
Die Wolf-Ferrarische, aus der Tradition von Pergolesi, Cimarosa oder Paisiello kommende Wiederbelebung und Neugestaltung der italienischen opera buffa, die dem musikalischen Komödienton völlig neue Qualitäten abgewinnt, sucht in der Musikgeschichte ihresgleichen. Tatsächlich hat der Komponist auch nie wirklich einen Nachfolger gehabt! Allein die Gestaltungsweise der Gesangspartien, die eine ganz eigentümliche Verbindung von rezitativischem Parlando und Arioso herstellt, offenbart – wenn auch in der Nachfolge des Verdischen Falstaff – neue Dimensionen. „Wenn man in Deutschland die italienische Lyrik des 16.Jahrhunderts besser kennen würde“ schreibt Wolf-Ferrari an Hans Pfitzner 1905 aus Venedig, „und an Monteverdi sehen würde, mit welchem Adel und ernsten Sinn gerade die Wagnerische Auffassung des Verhältnisses zwischen Dichtung und Musik in den Anfängen der dramatischen Musik in Italien herrschte, würde man das Wort „italienisch“ nicht immer mit dem tadelnden Beigeschmack nennen.“ Diese Zeilen meinen jene spezifische Behandlung von Wort und Ton, die in seinem Werk „als eine einzige unteilbare Willens- und Gefühlsäußerung“ erscheint. Das ist übrigens der Grund dafür, daß der Uraufführungsdirigent Felix Mottl „Susannens Geheimnis“ als die „wagnerischste Oper“ bezeichnet hat, ohne daß auch nur einmal Wagnerscher Orchesterton angeschlagen würde.
Denn Wolf-Ferrari schafft eine hochpersönliche Orchestersprache, die einem schon in den ersten Takten der Ouvertüre anspringt. Sie ist nicht nur paradigmatisch für die Kulturenverschmelzung seines OEvres, sondern darf auch als eines der herrlichsten Beispiele italienischer Lustspiel-Vivacitá angesehen werden. In ihrer melodischen Glückseligkeit und ihrem mediterranen Freiheitsdrang ist sie verliebt in das Leben selbst, birst vor Erfindungskraft, ist launig, übermütig und selig zugleich. Mit Humor führt sie auch den Kontrapunktiker vor, wenn in nicht einmal drei Minuten vier(!) Themen eingeführt und am Ende gleichzeitig zum Erklingen gebracht werden. Ein Kabinettstück! Nur selten wurde in solcher Kürze soviel an handwerklichen Nuancen und kontrapunktischer Spielerei „untergebracht“, ohne daß man auch nur in einem Moment das Gefühl von Konstruktion hätte. Spielerisch singt der Italiener hier den deutschen Kontrapunkt, dessen perfekte Beherrschung er souverän, sozusagen mit einer Hand in der Hosentasche, zur Schau stellt. In der Oper selbst ist dem Orchester ein durch und durch eigenständiger Part zugewiesen, der nie begleitende Funktion innehat, sondern immer kommentierend, dialogisierend oder psychologisch durchleuchtend ist. Nicht selten bricht eine Art „altvenezianischer“ Orchesterton hervor, der ebenso zu den Eigentümlichkeiten des Stils von Wolf-Ferrari gehört und überhaupt nicht beschrieben werden kann.
Zahllose Details machen diese Musik unendlich liebenswert: die Vorliebe für den neapolitanisch-wilden Tarantella-Rhythmus etwa, der, zumeist abgemildert und stilisiert, durch fast alle seiner Werke geistert. In „Susannens Geheimnis“ taucht er schon in der Auftrittsmusik des Grafen Gil auf – als unterschwellige Ankündigung seines sanguinischen Temperaments, bis sich der wahre Zorn in einem heulenden Orchestertumult entlädt, der uns gräßlich um die Ohren pfeift. Hier wird glänzend persifliert und die Musik gegen Ende der Szene auch noch mit einem Zitat aus der 5.Symphonie von Beethoven pseudopathetisch an einen der dramatischsten Momente der Symphonik angelehnt.
Zum Kostbarsten der Wolf-Ferrarischen Musik zählt die psychologisch überfeine Behandlung des thematischen Materials. Es ist ganz und gar zauberhaft, wie „unschuldig“ Susanna im Nebenzimmer das Klavier spielt (der Komponist nennt das vorgestellte Thema die „Jungfernmelodie“) während ihr Gemahl parlierend-cantabel vor sich hin grübelt und in zahlreichen Facetten Misstrauen, Eifersucht und leise Verzweiflung hörbar macht (Track 4). Nur wenig später wird dieses Thema als Zwischenspiel fungieren, als Ausblendung der ersten großen Eifersuchtsszene zwischen Susanna und Gil. Während sich die Klarinette dort mit goldener Milde in das beruhigend Gefühlsame hineinträumt (=das Äußere der Situation) bebt der Streit noch leise mit dem heulenden „Streit-Motiv“ in den Ersten Violinen nach (=das Innere der Personen). (Track 9) Ein meisterlicher Übergang! Am Ende der Oper schließlich wird die „Jungfernmelodie“ zum hymnischen Abgesang auf die Liebe transformiert, um turbulent in die Musik der Ouvertüre zu münden. (Track 14) Es gehört zur großen Kunst, wie Wolf-Ferrari mit geringen Mitteln die Metamorphose einer Melodie herzustellen vermag, die eigentlich immer dieselbe bleibt!
Melos – an seiner Kraft hielt Wolf-Ferrari Zeit seines Lebens fest und scheute sich nicht, Liedhaftes, Arioses, beseelte (aber unsentimentale) Barcarolen oder Gassenhauer zu schreiben. Das gehörte zu seiner romanischen Ader und damit zu seinem Selbstverständnis. Natürlich unterstrich es auch die Verbindung zum venezianischen Volk, die ihm, dem München zur Wahlheimat geworden war, nie abhanden kam. In Venedig, so schrieb Goldoni einmal, werde auf allen Plätzen, Straßen und Kanälen gesungen; von Kaufleuten, Arbeitern und Gondolieri. Diese Urbeziehung zum Melodischen steckt deshalb auch in der Sprache selbst. Wolf-Ferrari antwortete einem Deutschen immer in dessen Muttersprache, schlug mit zunehmendem crescendo des Gespräches dann oft in das Italienische um, und verfiel im emotionalsten Moment in den venezianischen Dialekt! So fehlen melodische Höhepunkte in keiner seiner Opern, auch in „Susannens Geheimnis“ nicht, ja vielleicht findet sich hier sogar das Innigste, was wir aus seiner Feder erhalten haben: das wolkenleichte Liebes-Duettino „Il dolce idilio“ im 3/4-Takt zum Beispiel (Track x), mit dem die beiden Protagonisten in wahrhaft paradiesische Gefühlsbereiche vordringen. Umso heftiger wirkt der darauf hereinbrechende Zorn des Grafen.
Ein tiefes, liegendes „d“ der Oboe ist der leere, herbe Nachklang der zweiten Streitszene zwischen Gil und Susanna. Mit nur einem einzigen Streicherakkord, über den die Klarinette mildes Licht strahlt, zaubert Wolf-Ferrari hier erneut einen Atmosphärenwechsel, der seinesgleichen sucht und den genialen Minimalisten erkennen läßt. Die Musik richtet den Blick auf Susanna und ihr magisches Zigarettenpäckchen, mit dem sie nun erschöpft aber glücklich in den Schaukelstuhl sinkt, um sich heimlich dem Tabakgenuß hinzugeben. Mit herausragender Intuition für Orchestrierung ist nicht nur der sich im Raum ausbreitende Rauch „akustisch sichtbar“ gemacht, sondern auch das sinnbetörende Nikotin fühlbar, das jetzt durch Susannens Adern streicht. Celesta, Harfe, 3 Solo-Violinen und gedämpfte Streicher hüllen sie in jenen blauen Dunst, der der Auslöser für eine zauberhafte kleine Oper gewesen ist, in der einiges, im Grunde aber rein gar nichts geschieht; und die will, allen Worten zum Trotz, nichts mehr sein als – Musik!